Geschichtliche Entwicklung der Heimcomputer und Konsolen
Diese Seite und Unterseiten zeigen die Geschichte der persönlichen Computer und Videospielkonsolen mit Beispielen aus den Sammlungen. Die Sammlungen umfassen verschiedene Modelle, Zubehörteile und Software, die die technischen und kulturellen Entwicklungen in diesem Bereich widerspiegeln. Die Entwicklung ist in Sektionen gegliedert, die jeweils eine bestimmte Zeitperiode oder einen bestimmten Aspekt behandeln. Jede Sektion besteht aus mehreren Sequenzen, die einzelne Themen oder Ereignisse vertiefen.
Inhaltsverzeichnis
Geburt der digitalen Informationsverarbeitung
Grundlagen der Informationsverarbeitung
In der elektronischen Datenverarbeitung gibt es zentrale Meilensteine. Zu den Themen gehören:
- Zahlen und Rechenmaschinen
- Binärsystem (Dualsystem)
- Digitalrechner vs. Analogrechner
- Relais-Computer
- Elektronenröhren-Computer
- Diskrete Bauteile
- Der Integrierte Schaltkreis (IC)
- Mikroprozessor (CPU)
Rechnergeschichte
Es dauerte mehr als 30 Jahre, bis die Computer persönlich wurden. Zuerst gab es nur Großrechner und Mini-Computer, bis die ersten Heimcomputer auf den Markt kamen.
Taschenrechner
Erschwingliche „Computer“ der ersten Stunde sind die Taschenrechner. Sie entwickeln sich rasant. Anfangs bieten sie nur die Grundrechenarten, später weitere Funktion. Moderne Taschenrechner sind frei programmierbare Rechenkünstler, mit einem leistungsfähigen Computeralgebrasystem.
Computer für Bastler
Persönliche Computer/Heimcomputer
Kurz gesagt sind Heimcomputer günstige persönliche Rechner, die sich Privatpersonen leisten können. Damit grenzen sie sich gegen teure Großrechner für Unternehmen und Verwaltungen ab. Die Hochphase liegt in den 1970er- und 1980er-Jahren, bis der IBM-kompatible PC in der Hardware einen Standard setzt und DOS, Windows und Linux zu den Standard-Betriebssystemen werden. Heimcomputer bilden einen Schwerpunkt der Sammlung und nehmen den größten Raum ein.
Computer für Bastler
Die ersten Heimcomputerbesitzer sind Bastler, die Baupläne in Zeitschriften finden, und mit viel Enthusiasmus und Geschick ihre eigenen Computer mit den ersten CPUs aufbauen und programmieren. In der Zeit kommen die Namen Bill Gates und Steve Jobs erstmals in die Presse.
Die Geburt einer Industrie, die Geburt einer Kultur - Von den ersten Experimenten zum weltweiten Phänomen
Großrechner-Spielereien finden unbemerkt von der Öffentlichkeit statt. Nachdem Ralph Baer (1922 - 2014) erfolgreich experimentiert und einen Prototypen für eine Spielekonsole entwickelt hat, beginnt im Jahr 1972 das bahnbrechende Zeitalter der Videospiele. Diese Innovationen, die bisher unbemerkt von der Öffentlichkeit stattgefunden haben, markieren einen Wendepunkt in der Unterhaltungselektronik. Die Einführung der Magnavox Odyssey und Ataris Pong, die nur wenige Monate voneinander entfernt auf den Markt kommen, läutet eine Ära ein, die die Art und Weise, wie Menschen spielen und unterhalten werden, für immer verändern wird.
Besonders der weltweite Erfolg von Pong macht Atari zu einem unangefochtenen Marktführer. Zunächst dominiert Atari das Automatengeschäft, und ab 1977 setzt das Unternehmen diesen Erfolg mit dem Atari VCS auch im neu entstehenden Konsolenmarkt fort. Die Vielfalt an verschiedenen Systemen und Spielen führt zu einer exponentiellen Wachstumsphase in der Industrie. Es scheint, als ob die Videospiele-Industrie unaufhaltsam expandiert.
Jedoch ist diese Blütezeit von kurzer Dauer, denn das Überangebot an Systemen und Spielen bildet eine Blase, die zwangsläufig platzen wird. Der scheinbar endlose Boom wird von den wachsenden Herausforderungen begleitet, die mit der Vielzahl von Angeboten einhergehen. Es entsteht eine Situation, in der die Industrie vor der Herausforderung steht, die Qualität und Innovation aufrechtzuerhalten, um dem Druck des Marktes standzuhalten.
Trotz des drohenden Platzens der Blase bleibt die Ära der Videospiele ein Meilenstein in der Geschichte der Unterhaltungselektronik. Die Grundlagen, die in den frühen 1970er-Jahren gelegt wurden, haben den Weg für die Entwicklung hochmoderner Spielekonsolen und interaktiver Unterhaltungserlebnisse geebnet, die auch heute noch einen festen Platz in der Welt der Technologie und Unterhaltung haben.
Spiele im Labor

Die Geschichte der Videospielkonsolen beginnt bereits Jahrzehnte vor der ersten kommerziell erhältlichen Maschine. Computer sind in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich in öffentlicher Hand und dort meist den technischen Universitäten vorbehalten. Auch lässt sich nur bedingt von Computern im heutigen Sinne sprechen, denn in puncto Aussehen, Bedienung und Leistung haben sie wenig mit unserer heutigen Vorstellung eines Rechners zu tun – eher erinnern sie an komplexe Versuchsanordnungen.
Angesichts von Geräten, die schon ihrem Äußeren nach wenig festgelegt wirken, überrascht es nicht, dass Forscher*innen überlegen, welche alternativen Anwendungsmöglichkeiten es geben könnte. Das Erproben und Demonstrieren der Technik steht dabei im Vordergrund, doch aus diesem spielerischen Zugang heraus entstehen die ersten Videospiele. Diese experimentelle Phase endet 1971 mit Computer Space, dem ersten kommerziellen Computerspiel.
Elektronisches Spielzeug

Spielkonsolen sind nur ein Aspekt des elektronischen Spielens für Heimanwender. Ab Ende der 1970er-Jahre setzen zahlreiche Spielzeuge und Gesellschaftsspiele auf digitale Technik; auch werden mit aus heutiger Sicht bescheiden wirkenden Mitteln Spielhallenspiele adaptiert.
Die Magnavox Odyssey
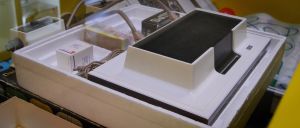
Ralph Baer (1922 – 2014) kommt im Jahr 1966 die Idee, Fernsehgeräte für Spielzwecke zu verwenden. 1979 präsentiert der in Deutschland geborene und in die USA immigrierte Erfinder seine „Brown Box“ verschiedenen Fernsehherstellern. Nach anfänglichen Zögern der Industrie übernimmt 1971 Magnavox die Lizenz und produziert mit der Odyssey die erste kommerzielle Spielkonsole für den Heimanwendermarkt – der Beginn der Videospielindustrie.
Die wenigen weißen Punkte und Blöcke auf schwarzem Hintergrund werden durch nur 40 Transistoren dargestellt. Mit verschiedenen Zusätzen wie Folien für den Fernseher, Würfeln oder Chips können je nach Version der Odyssey zehn bis 28 Spiele gespielt werden, wobei die Varianten sich oft nur durch die verwendeten Folien unterscheiden.
Atari und Pong

Der Elektrotechniker Nolan Bushnell sieht während seines Studiums Spacewar! und glaubt, dass sich das Spiel kommerziell verwerten lässt. Die Adaption, die er 1971 zusammen mit seinem Kollegen Ted Dabney unter dem Namen Computer Space baut, bleibt erfolglos, Bushnells Vermutung nach, weil die Bedienung zu komplex ist. Als er 1972 einer Präsentation der Odyssey beiwohnt, wird das darin enthaltene Tennisspiel zur Inspiration für Pong, ein Spiel mit nur zwei Drehknöpfen und der simplen Anleitung „Avoid missing ball for high score“.
Wenige Tage nachdem Bushnell und Dabney den Prototypen in einer Bar aufgestellt haben, funktioniert das Gerät nicht mehr, denn der Münzschacht ist übergequollen und noch immer bilden Menschen bereits vor Öffnung der Bar eine Schlange, um spielen zu können.
Der Erfolg zieht Nachahmer an, aber weil die neu gegründete Firma Atari, Inc. noch kein Patent angemeldet hat, bleibt ihr nur übrig, Innovationen zu produzieren – der Beginn der modernen Videospiel-Geschichte.
Generation 1

Die erste Generation der Spielkonsolen bietet ausschließlich eine feste Anzahl Spiele, da die Geräte keine CPU im eigentlichen Sinn besitzen. Die Spiele sind mit einfachen elektronischen Schaltungen realisiert, später entwickelte General Instrument den Chip AY-3-8500, der in tausenden Konsolen verbaut wurde. Zu den populärsten Spielen zählte Pong; daher ist der Name Pong-Konsolen für die Telespiele der 1. Generation geläufig. Einem breitem Publikum stellte Thomas Gottschalk die Konsolen Ende 1977 in der Sendung „Telespiele“ vor. Währenddessen füllen sich die Kneipen mit Arkade-Automaten.
Interton - Der einzige deutsche Konsolenhersteller

Der 1962 gegründete Kölner Hörgerätehersteller Interton steigt in den 1970er-Jahren ins lukrative Elektronikgeschäft ein, mit Taschenrechnern, Telefonanlagen, Auto-Bordcomputern – und Videospielkonsolen. Anfangs handelt es sich dabei um die üblichen Pong-Konsolen, später produziert Interton zwei modulbasierte Geräte.
Die in den Konsolen verbaute Technik stammt nicht von Interton, wohl aber das Design. Interton ist der bis heute einzige deutsche Spielkonsolenhersteller, der seine Geräte zudem vollständig in Deutschland produziert hat.
Interton zieht sich nach dem Videogame-Crash von 1983 aus dem Elektronikgeschäft zurück und produziert seitdem wieder Hörgeräte. 2005 wird die Firma von der GN ReSound Group aufgekauft. In der offiziellen Firmenhistorie taucht die Episode, in der Interton Konsolen produzierte, nicht auf.
Das Goldene Zeitalter der Spielhallenspiele
Unter dem „goldenen Zeitalter“ für Spielhallen wird die Zeit von ungefähr 1978 (Veröffentlichung von Space Invaders) bis etwa 1983 (Veröffentlichung von Nintendos Famicom in Japan) gefasst. In dieser kurzen Zeitspanne erleben Spielhallen ein nie wieder erreichtes Maß an Innovation, sowohl technisch als auch gestalterisch, bis ihnen in den 1980er-Jahren Heimkonsolen langsam den Rang ablaufen.
Viele Figuren, die in dieser Zeit entstehen, werden auch für Menschen, die nichts mit Videospielen zu tun haben, Teil des popkulturellen Gedächtnisses: Die Form der Space Invader, Pac-Man, Donkey Kong und Mario (zu dieser Zeit noch Jumpman genannt), um nur einige zu nennen.
Spielhallenspiele wirken sich unmittelbar auf den Markt für Heimkonsolen aus – die Qualität und Atmosphäre einer Spielhalle auch im heimischen Wohnzimmer zu ermöglichen, wird für Hersteller und Spieler auf Jahre hinaus zum Maß aller Dinge.
Generation 2 - Ein neuer Markt

Die zweite Generation der Spielkonsolen ist prägend für das, was heute gemeinhin unter dem Begriff „Videospiel“ verstanden wird. Spiele sind nun nicht mehr fest in den Konsolen installiert, sondern können auf Modulen zugekauft werden, die keinen Prozessor mehr enthalten, sondern nur das eigentliche Spiel. Die Grafik ist mehrfarbig und die Auflösung so hoch, dass Objekte und Landschaften unmittelbar als solche zu erkennen sind. Anstatt simpler Signalgeräusche spielen die Konsolen inzwischen mehrstimmige Musik.
Auch die Entwicklung beinahe aller noch heute existierenden Genres fällt in diese Epoche (wobei sie teils zuerst in den Spielhallen auftauchen), egal ob Shoot'em up (Space Invaders, 1978), Adventures (Adventure, 1979) oder Platformer (Pitfall!, 1982).
Der Erfolg dieser Konsolen übertrifft den der Pong-Telespiele noch bei Weitem. Innerhalb von nicht einmal fünf Jahren entsteht so eine milliardenschwere Industrie, die von Kreativität, Vielfalt und Innovationsreichtum geprägt ist.
Peripherie der Generation 2

Zum Spielen eines Konsolenspiels benötigt man nur die Konsole selbst, ein Modul, einen Fernseher und einen Controller. Gleichwohl erscheint ab der zweiten Generation zahlloses Zubehör, das entweder das Erlebnis für einzelne Spiele oder die Konsole selbst erweitern.
Umsetzungen von Arcade-Games spielen zu dieser Zeit eine große Rolle. Diese basieren immer auf einer optimal angepassten, aktuellen Hardware, während die Konsolen unveränderlich sind. Für ein authentisches Spielerlebnis müssen sie daher nachgerüstet werden, mit Controllern, die den Vorbildern entsprechen oder technischen Gadgets wie Modulen für Sprachausgabe. Die meisten dieser Erweiterungen unterstützen nur eine Handvoll Spiele und sind jenseits dessen nutzlos.
Ein anderer Trend ist der Ausbau der Konsole zu einem Heimcomputer, aber alle Projekte dieser Art scheitern entweder oder bleiben hinsichtlich ihrer Verkaufszahlen bedeutungslos.
Activision und der Aufstieg der 3rd-Party-Entwickler (In Vorbereitung)
In den ersten Jahren der Heimkonsolen-Industrie werden Atari-Spiele ausschließlich von Atari veröffentlicht, Colecovision-Spiele von Coleco, und so weiter. 1979 dann wird vier Spieldesignern bei Atari bewusst, dass ihre Spiele ihrem Arbeitgeber Millionenumsätze einbringen, sie selbst aber anonym und für ein Festgehalt arbeiten. In einem Gespräch mit Atari-Chef Ray Kassar fordern Larry Kaplan, Bob Whitehead, Alan Miller und David Crane deshalb Tantiemen und eine Nennung ihres Namens auf der Titelseite der Spiele. Kassar entgegnet, die vier seien nichts als Handtuch-Designer, deren Job jeder andere genauso machen könnte.
Kaplan, Whitehead, Miller und Crane kündigen daraufhin und gründen Activision, den ersten 3rd-Party-Publisher der Videospielgeschichte (dessen Name nicht zuletzt entsteht, um mit „Activision“ noch vor „Atari“ im Telefonbuch zu stehen). Atari klagt erfolglos gegen die neue und überaus erfolgreiche Firma, die ihre Designer in den Vordergrund stellt und als Stars inszeniert.
Die ersten Komplettrechner
Es folgen Komplettrechner wie der Commodore PET-2001 und Zubehör. Das CP/M Betriebssystem und Word Star entsteht, Netzwerke verbinden Computer, doch statt Internet für alle bleiben lange Zeit Zeitschriften die Quelle für Informationen.
8-Bit-Computer - Vom Hobby zum Massenmarkt
Die 8-Bit-Heimcomputer der frühen 80er-Jahre erreichen erstmals eine kritische Masse von Menschen, da sie erschwinglich und nutzerfreundlich sind. Während es funktionale Anwender-Software gibt, sind es nicht zuletzt Spiele, die die Rechner insbesondere für Jugendliche begehrenswert machen. Die entstehende Game-Industrie professionalisiert sich nach einer kurzen anarchischen Phase rasch und strebt im Rahmen des Wettbewerbs nach immer perfekteren und aufwendigeren Spielerlebnissen.
In der Hochphase der 8-Bit-Rechner betreten viele Unternehmen den Markt, bekannt wird in Deutschland der Commodore 64 und Rechner von Atari und der Schneider CPC. In Japan implementieren viele Rechner den MSX-Standard. IBM bringt den ersten 16-Bit-Konsumer-PC auf den Markt. Am Anfang läuft es schleppend, doch 20 Jahre später haben IBM-kompatible Rechner den Markt im Griff.
Der Konsolen-Krieg - Der Verdrängungswettbewerb der 80er- und 90er-Jahre und die daraus resultierenden Innovationen
1983 sind die Nutzer angesichts der Masse an verschiedenen Systemen und Spielen auf dem Markt zunehmend verunsichert, sodass wenige Ereignisse genügen, um den westlichen Markt zusammenbrechen zu lassen. Während das Geschäft in Japan weiter läuft, erholt sich der Westen erst 1985 langsam von der Krise. Es folgt ein gigantischer Wirtschaftskrieg zwischen den beiden großen Konkurrenten Sega und Nintendo sowie kleineren Hersteller auf zahlreichen Nebenschauplätzen. Die Technik entwickelt sich bedingt durch diesen Wettbewerb rasend schnell. Innerhalb von nur 15 Jahren werden Pixelgrafik und Chiptune-Musik von realistischen 3D-Darstellungen mit orchestraler Begleitung abgelöst. Die zweite Welle zahlreicher Konsolen verschiedener Hersteller führt nicht zum Crash, stattdessen reduziert sich das Feld auf die drei Firmen, die den Markt auch heute noch dominieren: Nintendo, Microsoft und Sony.
Der Videogame-Crash von 1983
Die Gründung von Activision ist Segen und Fluch für die Branche: Dass nun jedermann Spiele produziert, sorgt für einen explosionsartigen Zuwachs an Software. Für den Atari 2600 erscheinen 1982 und '83 zusammen etwa 300 Titel allein von Drittanbietern, während Atari selbst seit der Einführung des 2600ers nur knapp über 50 Spiele veröffentlicht hat. Dazu kommt, dass 1983 in den USA neun verschiedene Konsolen auf dem Markt sind, die alle um Marktanteile streiten.
Die Übersättigung des Marktes, die oft mangelhafte Qualität der Spiele von Drittanbietern und einige prominente Flops von Atari selbst führen 1983 zu einem Einbruch der Verkäufe in Nordamerika. Mattel, Coleco und MB sowie zahllose andere Hardware-Hersteller ziehen sich zurück. Unzählige Software-Firmen brechen zusammen. Atari verliert durch diesen Zusammenstoß etwa 500 Millionen Dollar (inflationsbereinigt etwa 1,2 Milliarden) und wird in mehrere Unternehmen zerschlagen, die außer dem Atari-Namen und -Logo nichts miteinander gemein haben.
Nintendo - Von Spielkarten zu Spielkonsolen

Nintendo wird 1889 als eine Firma für Kartenspiele gegründet. In den 1960er-Jahren experimentiert der Firmenerbe Hiroshi Yamauchi in anderen Geschäftsfeldern und gründet unter dem Namen Nintendo unter anderem ein Taxiunternehmen und eine Kette von Stundenhotels, und produziert ferngesteuerte Staubsauger. Alle diese Unternehmungen sind Fehlschläge, bis der überraschende Erfolg einer Teleskophand (entwickelt vom späteren Game-Boy-Erfinder Gunpei Yokoi) die Firma als Spielzeughersteller etabliert.
Mit dem Aufkommen elektronischen Spielzeugs wenige Jahre darauf produziert Nintendo eine Reihe von Lightgun-Spielen und bald danach Arcade-Spiele und Pong-Konsolen. Der weltweite Erfolg weiterer Yokoi-Entwicklungen wie der Game&Watch-Serie (1980) und dem Spielhallenhit Donkey Kong (1981; zusammen mit Shigeru Miyamoto) schließlich gibt der Firma den finanziellen Rückhalt, um 1983 mit dem Famicom eine Konsole zu entwickeln, die jahrelang den Markt dominieren wird.
Generation 3

Der Videogame-Crash hat den westlichen Konsolenmarkt zerstört. Mattel, Coleco und MB haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen, Atari kann mit dem Atari 7800 nicht an alte Erfolge anknüpfen, alle anderen westlichen Maschinen dieser Generation bleiben Exoten. Stattdessen setzen sich in den USA und in Europa Heimcomputer wie der Apple II, der C64 oder der ZX Spectrum durch und übernehmen eine Rolle als preiswerte Spielmaschinen, die darüber hinaus noch für Anwendungen geeignet sind und sich selbst programmieren lassen.
Für Japan ist der Videogame-Crash irrelevant. Nintendos Family Computer (kurz „Famicom“), anfangs in der Tat noch ein Hybrid aus Konsole und Heimcomputer, wird zum unangefochtenen Marktführer. Am selben Tag wie das Famicom erscheint die erste Spielkonsole einer Firma, die als „Service Games“ gegründet wurde und unter dem abgekürzten Namen „Sega“ zu Nintendos größtem Rivalen werden wird.
Spielstationen
Sechs Spielstationen laden die Besucher zum Zocken ein.
Die PC-Engine

Die PC Engine wird in unterschiedlichen Ländern unter anderen Namen und teils völlig anderem Design vertrieben. Auch bezüglich ihrer Technik unterscheiden sich die Maschinen marginal voneinander, sodass Spiele nicht zwangsläufig auf allen Mitgliedern dieser Konsolenfamilie laufen.
Das ursprüngliche Modell hält einen Rekord als kleinste Konsole. Auch die Spiele werden nicht auf großen Modulen ausgeliefert, sondern auf sogenannten HUCards in Scheckkartengröße.
Die Koproduktion von Elektronikhersteller NEC und Spieleproduzent Hudson Soft ist in mehrfacher Hinsicht innovativ, es ist die erste Konsole mit 16Bit-Technik (enthält aber noch einen 8-Bit-Prozessor) und 1988 die erste Konsole mit CD-ROM-Erweiterung.
Der Erfolg der PC Engine schwankt stark, abhängig von der Region. In Japan verkauft sie sich sehr gut, in den USA erzielt sie (unter dem Namen TurboGrafx-16) einen Achtungserfolg, in Europa bleibt sie ein Exot für eine eingeschworene Fangemeinde.
Generation 4 - Der große Konsolen-Krieg
Nintendo und Sega befinden sich im staken Wettbewerb und die 4. Generation bringt die besten 2D-Spiele auf den Markt.
Das Neo Geo
SNK konzipiert das Neo Geo als Spielhallen-Hardware, die es Ausstellern ermöglicht, Spiele auszutauschen, ohne jedes Mal ein neues Kabinett anschaffen zu müssen. Parallel dazu bietet man eine Version an, die in Videospielläden geliehen werden kann. Die große Nachfrage überzeugt SNK davon, diese Heimversion im Jahr darauf in den Handel zu bringen.
Kommerziell erfolgreich ist die Konsole nicht, das aber ist auch nicht SNKs Intention. Das Neo Geo wird als Luxusgerät vermarktet und ist mit Preisen von (in Deutschland) etwa 1000 DM für das Grundgerät und 300 bis 400 DM pro Spiel jenseits dessen, was durchschnittliche Spieler zu zahlen bereit wären. Für diese Summen, die drei- bis zehnmal über denen für andere Konsolen liegen, bekommen die wenigen Enthusiasten ein Spielerlebnis, das dem aus der Spielhalle entspricht. Die Technik des Neo Geo ist so überragend, dass neue Spiele noch bis 2004 erscheinen – 13 Jahre nach der Einführung.
Konsolen im HiFi-Regal

Ab den 1990ern werden Konsolen zu einem Standard der Wohnzimmereinrichtung. Die Industrie trägt dieser Entwicklung Rechnung und produziert Geräte, die weniger wie Konsolen aussehen und sich stattdessen der aktuellen Optik klassischer Unterhaltungselektronik anpassen. Erstmals werden so Geräte, deren wesentlicher Aufgabenbereich Videospiele sind, an Erwachsene vermarktet. Dies ist ein Nebenschauplatz einer Entwicklung, die auch bei klassischen Konsolen zu beobachten ist – die beworbene Zielgruppe wird zusammen mit dem Medium älter. Diese Erkenntnis ist maßgeblich für die Entwicklung von Videospielen von einer flüchtigen Mode hin zu einem etablierten gesellschaftlichen Faktor.
Dem Zeitgeist entsprechend bewirbt man diese Geräte als Multimedia-Abspielstationen. Das scheitert, weil die Maschinen (neben ihren Möglichkeiten als Spielkonsolen) beschränkt sind auf Videosequenzen in niedriger Qualität, auf die Darstellung von Bildern und auf Anwendungen mit geringer Interaktivität.
Generation 5 - Goldgräber und Revolutionäre

Die fünfte Generation der Spielkonsolen ist gekennzeichnet von zahlreichen Umbrüchen. Spiele im dreidimensionalen Raum werden zum Standard, CD-ROMs lösen die seit zwanzig Jahren etablierten Module als Medium ab und erlauben mit ihrem zigfach höheren Speicherplatz aufwendige Filmsequenzen, Sprachausgabe und Musik in CD-Qualität.
Zahlreiche Hersteller versuchen, den Erfolg, den Sega mit dem Mega Drive hat, zu kopieren; nie wieder gibt es so viele unterschiedliche Konsolen gleichzeitig auf dem Markt wie in der fünften Generation. Fast alle sind Flops.
Sega selbst verspekuliert sich mit der Veröffentlichung des Saturns und wird sich von diesem Schlag nicht mehr erholen. Währenddessen führt eine gescheiterte Kooperation zwischen Nintendo und Sony dazu, dass Sony mit der PlayStation eine eigene Konsole entwickelt und fast über Nacht zum Branchenführer aufsteigt.
Kopierstationen, Flash- und Cheatmodule

Ein vermeintlicher Unterschied zwischen Heimcomputern und Konsolen ist, dass sich die Module für Nintendo, Sega und co. nicht kopieren lassen. Tatsächlich ist dies aber ab den 1990er-Jahren möglich. Unbeachtet von einer breiteren Öffentlichkeit erscheinen Kopierstationen, die zwischen Konsole und Modul gesteckt werden, und mit denen sich die Spiel-Daten auf eine Diskette oder (später) CD-ROM überspielen lassen.
Diese Stationen sind zunächst ein Nischenprodukt, zumal Nintendo ab der fünften Konsolengeneration der einzige große Hersteller ist, der überhaupt noch Module anbietet. Gerade Nintendo aber sieht in den Kopierern ein potenzielles Problem: Die Datenmengen der Module sind eher gering, gleichzeitig werden Internetverbindungen immer schneller, was eine komfortable Verbreitung der Raubkopien unter Spielern ermöglicht. Nintendo klagt weltweit gegen die Hersteller. Diese aggressive Strategie hat Erfolg, bis heute ist nur wenigen Spielern die Existenz der Kopierstationen bewusst.
Generation 6 - Das Ende der Konsolenkriege

Sega ist der erste Hersteller, der mit dem Dreamcast eine Konsole der sechsten Generation vorstellt, aber der angeschlagene Konzern hat nach den vorangegangenen Flops nicht mehr die Rücklagen, um gegen die bald darauf erscheinende Ps2 bestehen zu können. Sonys Konsole wird zur bis heute meistverkauften, während Nintendo mit dem GameCube ein Achtungserfolg gelingt. Microsoft stößt als neuer Konsolenhersteller hinzu, aber davon abgesehen lichtet sich das Feld: am Ende dieser Generation bleiben nur die drei Unternehmen übrig, die bis heute dominieren.
Dies markiert das Ende der Konsolenkriege. Die Technik ist inzwischen so weit standardisiert, dass Unterschiede zwischen den Maschinen ohnehin nicht mehr sonderlich ins Gewicht fallen, und allgemein werden Konsolen den PCs ähnlicher, durch Datenträger im Gigabyte-Bereich und Online-Funktionen.
Das gilt auch für die Spiele; viele erscheinen nicht mehr exklusiv für eine einzige Konsole, sondern sowohl für PCs als auch für XBox, GameCube und PS 2.
16- und 32-Bit-Computer - Digitale Künstler, blühende Szene
Die 16/32-Bit-Geräte kommen, darunter Medienwunder wie Amiga, Atari oder Acorn. Besonders relevante Themen sind: Hardware, Grafik, Sound, Spiele, Spielkultur in Deutschland (mit dem Unterpunkt Raubkopierer-Szene). A.Eon und ACube stellen bis heute Amiga-Computer her, Hyperion entwickelt aktiv das AmigaOS weiter. Die Sektion ist nicht streng nach technischen Gegebenheiten organisiert, sondern in gleichem Umfang auch auf der Basis einer zeitlichen Einordnung in die Jahre von 1985 (Einführung von Atari ST und Amiga 1000) bis ca. 1993, wobei es Überschneidungen mit 8-Bit-Rechner gibt.
Spielen im Mikrokosmos und Makrokosmos - Mobile Gaming und Immersion
Videospiele und ihre kulturellen Codes prägen unsere heutige Welt. Das hat mehrere Gründe: Zum einen gibt es schon seit über 40 Jahren Videospiele, die für viele Menschen zu einem wichtigen Teil ihrer Lebensgeschichte geworden sind. Zum anderen sind Videospiele heute nicht mehr nur auf das klassische Setup (Fernseher, Konsole, Modul, Eingabegerät) beschränkt, sondern in vielen verschiedenen Situationen anzutreffen. Heute wird viel auf mobilen Geräten gespielt, aber auch versucht, die Spieler tiefer in das Geschehen einzubeziehen, indem man ihre Körper mit dem Spiel verbindet – bis zu Virtual Reality und aufwändigen Simulatoren.
Immersion durch alternative Peripherie

Während sich die typische Videospielsteuerung mit Richtungstasten und Feuerknöpfen schon sehr früh herausbildet, gibt es durch die Geschichte der Spielekonsolen hindurch auch zahlreiche alternative Steuerungsmethoden. Dabei handelt es sich nicht nur um an das Spielgeschehen angepasste Controller-Varianten wie Paddle oder Trackball. Teils sind es speziell geformte Controller, die dem Thema des Spiels entsprechen, oft aber auch Versuche, den ganzen Körper der Spieler einzubeziehen.
Dahinter steht das Bemühen, eine Steuerung zu schaffen, die sich natürlicher anfühlt, um so ein intensiveres, vereinnahmendes Spielgefühl zu schaffen. Dieses Bemühen um Immersion ist mal mehr, mal weniger effektiv, denn während die Idee so alt ist wie die Geschichte der Videospiele, ist die Technik oft noch nicht so weit, um die Konzepte effizient umzusetzen. Erst in den 2000er-Jahren gelingt Nintendo mit der Wii eine Körpersteuerung, die ausgereift genug ist, um mehrheitsfähig zu werden.
Generation 7
Der Konsolenmarkt wird in der siebten Generation von den drei verbliebenen großen Unternehmen bestimmt. Ihre Maschinen sind nun ab Werk für Online-Funktionen ausgerüstet, Xbox 360 und PlayStation 3 präsentieren Grafik in HD-Auflösung, die wesentliche Neuerung in dieser Generation besteht aber im Controller-System der Wii. Erstmals setzt eine Konsole ganz auf eine Steuerung über Bewegungssensoren – eine neue Spielerfahrung, die Nintendo neue Käuferschichten erschließt und Millionen einbringt. Sony und Microsoft ziehen bald mit PlayStation Move und Kinect nach, doch die Wii verkauft sich häufiger, der schwächeren Grafik zum Trotz.
Während in der vorangegangenen Generation hauptsächlich das Äußere der Konsole durch Kunden wählbar ist, sind Xbox 360 und PlayStation 3 hinsichtlich ihrer Hardware konfigurierbar und werden mit unterschiedlich großen internen Festplatten produziert – die Ähnlichkeiten der Konsolen zu hochgezüchteten Spiele-PCs werden immer größer.
Generation 8

Nach erfolglosen Versuchen seit den 1990er-Jahren sind die Konsolen der achten Generation jetzt echte Multimedia-Maschinen, die nicht nur Spielgeräte sind, sondern als Unterhaltungszentren im Wohnzimmer fungieren. Sie sind außerdem Social-Media-Maschinen, die Spieler durch zahlreiche Online-Funktionen mit Gleichgesinnten verbinden und es ermöglichen, Spielsituationen auf Facebook oder Twitter zu teilen.
Alle drei Konsolen werden zumindest teilweise beim chinesischen Hersteller Foxconn gebaut. Auch die Chip-Architektur der drei Geräte ähnelt einander stark und unterscheidet sich nicht mehr wesentlich von der eines Spiele-PCs. Vielfach äußert sich der Unterschied nur noch in einer bei Konsolen komfortableren Handhabung.
Weit mehr als die Hälfte aller verkauften Konsolen sind PlayStation 4, in einigen Märkten liegt Sonys Anteil bei 70 bis über 90 %.
Next Gen - Das Ende der Generationen
Ab Mitte der 2010er-Jahre ist es kaum noch möglich, Konsolen in Generationen einzuteilen. Der bisherige, Jahrzehnte alte Zyklus von etwa sieben Jahren pro Generation, sowie die bislang klaren Trennlinien zwischen unterschiedlichen Generationen, sind damit hinfällig.
Einzig Nintendo stellt im selben Jahr mit der Switch eine neue Konsole vor, die aber ihrerseits Trennlinien auflöst – Die Switch ist ein Hybrid aus stationärer Konsole und Handheld.
Mobile Gaming

Die Menschheit ist, entwicklungsgeschichtlich gesehen, erst seit Kurzem sesshaft. Gespielt aber hat sie immer, weswegen auch die Idee mobilen Spielens bereits früh existiert. Würfel sind seit fünftausend Jahren bekannt, Schachspiele, die kompakt genug für das Reisegepäck sind, seit dem Mittelalter.
Ab dem 18. Jahrhundert gibt es zudem Steckschachspiele. Diese sind so konzipiert, dass die Figuren bei Erschütterungen nicht verwackeln können. Dies wird notwendig, denn die zunehmende Mobilität seit dem 18. Jahrhundert führt zu einem sich nun weit verbreitenden und für viele Menschen neuen Phänomen: Reisezeit, und damit einhergehend das Bedürfnis nach einer Beschäftigung während einer Warteperiode, in der man passiv sitzend auf wackelnden Kutschen oder schwankenden Schiffen von einem Ort zum anderen verbracht wird.
Bis zum Beginn des Elektronik-Zeitalters (und noch bis heute) erscheinen zahllose Spiele, deren Zweck es zuvorderst ist, allein oder mit Mitspielern Zeit totzuschlagen.
Virtuelle Realität
Virtual Reality ist über Jahrzehnte hinweg nicht viel mehr als ein Versprechen. Der Versuch, über eine bewegungssensitive Brille ganz in die Welten auf dem Monitor einzutauchen, entstammt dem Wunsch, ein Spielerlebnis nicht nur intensiver erleben zu können, sondern es tatsächlich zu leben – völlige Immersion und ultimativer Eskapismus.
Während es schon seit Längerem möglich ist, sich ein zweites Leben am Rechner aufzubauen – durch Online-Rollenspiele und Social Media – wird die Umsetzung von VR-Technik jahrelang durch zu geringe Rechenleistung behindert.
Als Spiele in den 1990er-Jahren dreidimensional werden, wird Virtual Reality ebenfalls kurzzeitig zu einem Modebegriff, auch befeuert durch die 2010er-Jahren ist die Technik weit genug, um bezahlbare und funktionale Brillen ermöglichen.
Simulatoren

Alle erfolgreichen Spiele zu Beginn der Videospielgeschichte sind Simulationen, angefangen mit Tennis in Pong. Hersteller von Spielhallengeräten werden dem bereits früh gerecht und bieten Geräte, deren Steuerungselemente den Originalen nachempfunden sind. Für den Heimgebrauch erscheinen bald darauf spezielle Controller, die dieses Spielgefühl übernehmen, aufgrund finanzieller und räumlicher Beschränkungen aber bleiben komplexe, den ganzen Körper miteinbeziehende Simulatoren eine Domäne von Spielhallen und professionellen Trainingszentren.
Dort allerdings haben Spieler die Möglichkeit, durch nachgebildete oder sogar authentische Cockpits eine Erfahrung zu machen, die sie bereits Jahrzehnte vor Virtual Reality Teil des Spielgeschehens werden lässt.
Game Studies
(In Vorbereitung.)
Mehr Dimensionen - Die Entgrenzung durch PCs und Mobilgeräte
Der PC, der ab den 1990er-Jahren immer mehr Verbreitung fand, war kein Produkt eines einzigen Herstellers, sondern bestand aus verschiedenen Alternativen, wie auch Linux oder OS/2. Der modulare Aufbau des PCs ermöglichte es, die Hardware individuell anzupassen und auszutauschen, was die Preise senkte und ihn zu einem Massenartikel machte.
Die technische Entwicklung des PCs war rasant und fokussierte sich primär auf zwei Aspekte: Miniaturisierung (und damit einhergehend Mobilität) und die Erweiterung von Darstellung und Interface um den dreidimensionalen Raum. Die Miniaturisierung führte dazu, dass die PCs immer kleiner, leichter und leistungsfähiger wurden, was die Entwicklung von Laptops, Tablets und Smartphones begünstigte.
Die Erweiterung um den dreidimensionalen Raum bedeutete, dass die Grafik, der Sound und die Steuerung der PCs immer realistischer und immersiver wurden, was die Möglichkeiten für Spieleentwickler enorm erweiterte.
Der Wegbereiter einer technischen Revolution war das Internet, das die Vernetzung und Kommunikation der PCs ermöglichte und ganz neue Formen von Online-Spielen, sozialen Netzwerken und digitalen Plattformen hervorbrachte.
Marktbereinigung durch IBM-Kompatible
Als der Markt mit IBM-kompatiblen Geräten aufblühte, konnten viele Heimcomputer-Hersteller nicht mit attraktiven Geräten nachziehen und zogen sich zurück oder mussten Insolvenz anmelden. Für den Standard-PC gibt es mehr und mehr Steckkarten und insbesondere im Bereich der Grafikkarten ist bis heute die Innovation spürbar.
Tragbare Computer
Tragbare Computer (Laptops) gibt es schon lange, doch es dauert zwei Jahrzehnte, bis sie günstig für alle sind.
Persönliche Assistenten
Kleine tragbare Computer entwickeln sich zu den persönlichen Computern überhaupt, angefangen von PDAs (Personal Digital Assistant) zu modernen Smartphones und Tablets.
Retro-Computing
Unzählige Nutzer und Entwickler arbeiten weiterhin mit Heimcomputern der 1980er-Jahre, pflegen, reparieren sie, schreiben neue Software und entwickeln frische Hardware. In einem Raum beschäftigt sich das Museum mit den Neuentwicklungen.
Heutzutage sind Kleinstrechner wie der Raspberry Pi so leistungsfähig, sodass sie problemlos Rechner der 8- und 16/32-Bit Generation inklusive aller Custom-Chips nachbilden (emulieren) können. Auch auf einem Tablet und Smartphone gibt es Emulatoren und sogar im Webbrowser in JavaScript geschrieben.